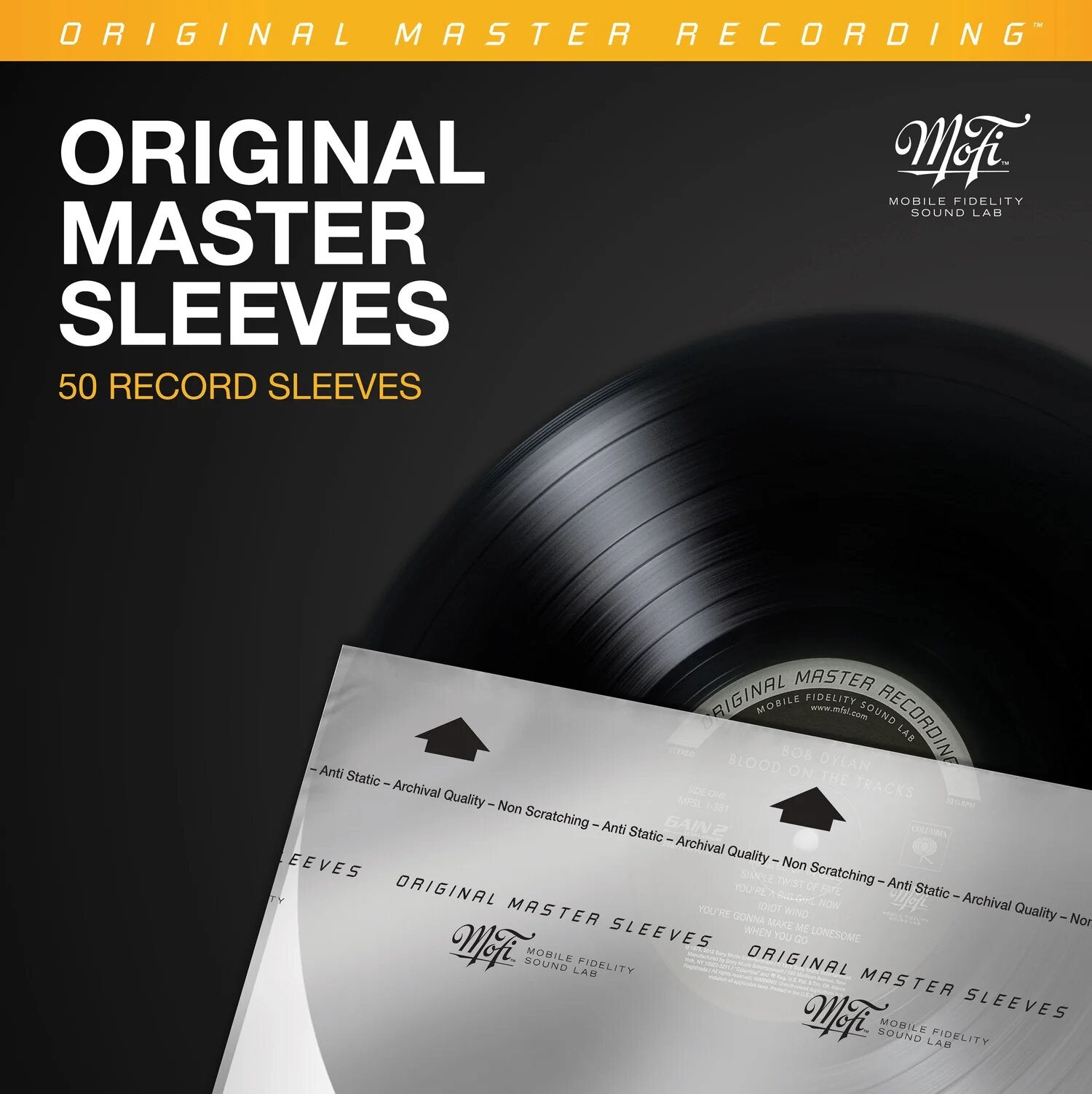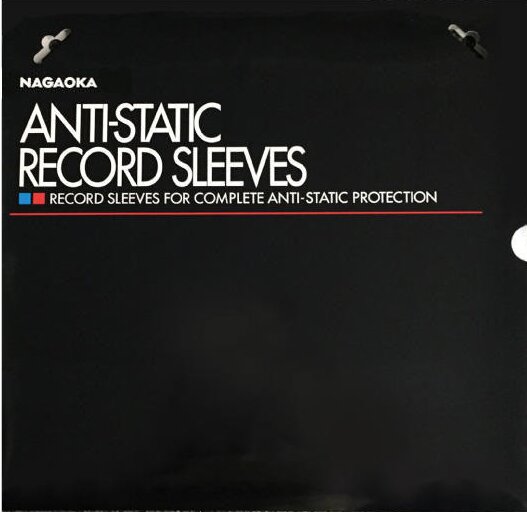Der Hauptfeind einer Schallplatte ist Staub. Ein weiterer Feind des Hörgenusses ist die elektrostatische Aufladung der Plattenoberfläche, die zwar der Platte selbst keinen Schaden zuführt, durch Spannungsüberschlage beim Abtasten aber als ein unangenehmes Knistern hörbar wird. Die Frage der statischen Aufladung ist mit dem Schutz vor Staub eng verknüpft, weil elektrische Aufladung ebenfalls die Ablagerung von Staub auf der Platte und in der Innentasche selbst begünstigt. Elektrostatische Aufladung präsentiert sich hier grundsätzlich als Reibungselektrizität – dabei findet auf molekularer Ebene ein Elektronenaustausch statt, der in einer sich steigernden Potenzialdifferenz resultiert, die sich dann über Entladungen wieder ausgleicht.
Staubschutz ist gewährleistet durch Innentaschen, die so weit wie möglich geschlossen sind und zum Beispiel keine ausgestanzten Mittellöcher enthalten. Innentaschen, die an den Ecken schräg abgeschnitten sind, sind dort meistens offen, was ebenfalls das Eindringen von Staub begünstigt. Einfaches Papier als Material hat eine faserige Oberfläche, die Staubablagerungen anzieht und Fasern selbst auf die Plattenoberfläche gelangen lässt. Je glatter die Oberfläche ist, umso geringer ist die „Speicherfähigkeit“ von Staub. Allerdings sorgen glatte Materialien dafür, dass Staubkörner immer an der Oberfläche bleiben und so die Platten stärker schädigen können, als wenn sie sich in den Fasern des Materials verstecken. Hinzu kommt eine gewisse Instabilität des Materials Papier. Zwar werden heute säurefreie Papiere verwendet, die durch Zersetzung nicht so stark altern. Trotzdem ist dieser Prozess nicht dauerhaft aufzuhalten: Papier altert und ist hygroskopisch, das heißt, es zieht Feuchtigkeit an, und die im Papier enthaltene Feuchtigkeit begünstigt mikroskopische Pilze, die ebenfalls in den Rillen der Platten wachsen und den Klang beinträchtigen können.
Papier ist überdies nicht leitend und anfällig gegenüber statischer Aufladung durch Reibung. Die gibt es an vielen Stellen: beim Rausziehen der Platte wie auch bereits bei der Fertigung der Innenhüllen, wenn diese durch Druck-, Falz- und Klebemaschinen laufen. Darüber hinaus sind Innentaschen aus Papier anfällig für sogenannte Seam Splits – also das Aufreißen an den Falzkanten durch das Ruckeln der Platten beim Versand und Transport. Bei Verwendung von beschichtetem Papier verringert sich dieses Risiko, was wiederum für bedruckte Innentaschen spricht, die üblicherweise aus beschichtetem Papier hergestellt sind. Hier sollte das Material allerdings möglichst dünn gewählt werden, weil beim Falzen durch Materialverdrängung und Spannung ein dickeres Papier stärkere Faserzerstörung aufweist und eine größere Gefahr für aufgerissene Kanten besteht.
Viele der beschriebenen Risiken lassen sich durch die Verwendung von Plastik-Innentaschen vermeiden, wobei es hier starke Unterschiede gibt. Denkbar ungeeignet sind Hüllen aus PVC. PVC ist ein instabiles Material, das sich schnell zersetzt und unter anderem Stabilisatoren, Weichmacher und Salzsäure freistellt, die wiederum mit dem PVC der Schallplatte reagieren. Daher sollte man lieber zu Innentaschen aus PE (Polyethylen) greifen, die heute vorwiegend als HDPE und LDPE verwendet werden. HDPE (HD steht für „high density“) hat eine höhere Dichte als LDPE (low density) und wird gerne als Reispapier bezeichnet, was es nicht ist, aber in seiner Anmutung an solches erinnert. HDPE wird heute mit verschiedenen Zusätzen wie PE-Glykol-Esthern, Glykol-Monostearat oder ethoxylierten Aminen veredelt, die das Material schwach leitfähig und daher antistatisch machen. Aus HDPE bestehen etwa die Original Master Sleeves von MFSL, die Anti-Static Record Sleeves von Nagaoka oder die Super-Premium-Sleeves von Sieveking. Als Standard haben sich die gefütterten Innenhüllen, auch als „polylined inners“ bekannten, etabliert, deren Füllung allerdings seltener aus HDPE, sondern meist aus LDPE besteht. Außerdem werden diese Innenhüllen auf teilweise sehr alten Maschinen in Rollenfertigung hergestellt, was sie rar und kostspielig macht. Sie sind etwa fünfmal so teuer wie eine Standard-Papiertasche.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Innentaschen aus HDPE oder LDPE die Nase gegenüber anderen Verpackungen klar vorne haben. Gerade im Hinblick auf elektrostatische Aufladung muss man allerdings das gesamte System betrachten: Ist der Plattenspieler ordentlich geerdet? Verwendet der Hörer eine antistatische Bürste oder ein Reinigungsspray, das antistatisch wirkt wie unser MINT Pure Sound oder das von Nagaoka? Steht er mit Turnschuhen auf einem Teppich aus Kunstfaser oder barfuß auf Parkett? Die Verwendung teurer antistatischer Innentaschen wird schon beim Abspielvorgang konterkariert, wenn man seinen Plattenteller beispielsweise mit einer Filzmatte ausgestattet hat, die bei DJs absolute Berechtigung hat, weil sie die Platte für das Scratchen beweglich hält, im Heimgebrauch aber im Vergleich zu einer Auflagematte aus Gummi, Kork oder Silikon beschichtetem Glasfasergewebe, wie die von Derenville, die in der Regel nur schwach leitend und daher antistatisch ist, ausgemachter Unsinn bleibt.